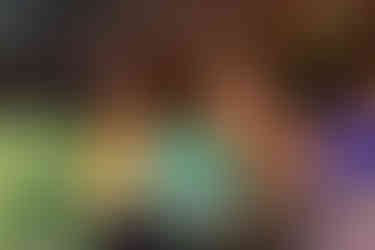Jetzt zu sehen: Vom Erinnern zum Gedenken
- Synagoge

- 16. Juni 2025
- 3 Min. Lesezeit
Am Freitag, den 13. Juni, wurde die Sommerausstellung der Synagoge Groningen eröffnet: 'Vom Erinnern zum Gedenken. Leben mit dem Krieg, nach dem Krieg'. Der Schriftsteller Ron van Hasselt und der Singer-Songwriter Jan Henk de Groot trugen zur Eröffnung bei. Die Kuratorin Lola van der Made gab eine Einführung in das Thema der Ausstellung. In Groningen blicken wir auf 80 Jahre Befreiung zurück. Ein Moment, den wir oft mit Freude und Feiern verbinden. Aber diese Ausstellung entstand aus einigen schwierigen Fragen über die Folgen des Krieges.

Wie kann man die Befreiung feiern, wenn man fast alles verloren hat? Wenn man nicht weiß, ob seine Eltern noch am Leben sind? Oder Ihre Kinder? Oder deine Freunde? Wie verarbeitet man das Trauma von Verfolgung, Ausgrenzung und Massenmord - als Individuum, aber auch als Gesellschaft? Um diese Fragen geht es in dieser Ausstellung. Um die Shoah. Und darüber, wie wir in Groningen - in der Stadt und in der Provinz - seit 80 Jahren nach Wegen des Erinnerns und Gedenkens suchen. Der Titel Vom Erinnern zum Gedenken zeigt schon etwas: Es gibt Bewegung. Die Ausstellung zeigt vier Bedeutungsebenen.
1. Vom Individuum zum Kollektiv
Der Titel Vom Erinnern zum Gedenken beschreibt einen Übergang vom Persönlichen zum Kollektiven. Während das Erinnern oft mit individuellen Erfahrungen beginnt, ist das Gedenken etwas, das wir gemeinsam tun. In der Öffentlichkeit, sichtbar für alle. In dieser Ausstellung zeigen wir, wie persönliche Geschichten mit der größeren Geschichte von Groningen verwoben wurden. Wie das Private auch zur öffentlichen Geschichte wurde. Von persönlichen Geschichten und stiller Trauer bis hin zu kollektiven Ritualen, Denkmälern und Gedenktagen. Das Gedenken ist somit zu einer Art und Weise geworden, wie wir als Gesellschaft versuchen, der Vergangenheit einen Sinn zu geben.
2. Von Emotion zum Ritual
Erinnerungen sind oft rau, konfrontativ und komplex. Sie können unerwartet auftauchen und sind oft stark emotional aufgeladen. Das Erinnern hilft, ihnen eine Form zu geben. Zum Beispiel durch Rituale, durch Stille, durch Zusammengehörigkeit. Wir suchen nach Sprache, nach Symbolen, nach Momenten, in denen wir Trauer, Verlust und auch Hoffnung teilen können. Das ist es, was diese Ausstellung sichtbar macht.
3. Von der Vergangenheit zur Gegenwart
Das Erinnern blickt auf die Vergangenheit: was geschehen ist, wen wir verloren haben, was unwiederbringlich zerstört wurde. Beim Erinnern hingegen geht es auch um die Gegenwart. Es ist ein aktiver Akt: Wir entscheiden uns für das Erinnern, weil wir glauben, dass die Vergangenheit eine Bedeutung für die Gegenwart hat. Wir beschließen, still zu stehen. Um Geschichten lebendig zu halten. Und um neue Generationen mit einzubeziehen. In der Ausstellung werden Sie sehen, wie jede Zeitperiode das Gedenken neu gestaltet. Nichts ist festgelegt - es bewegt sich mit den Fragen von heute.
4. Eine Warnung und ein Appell
Wir sind dabei, die letzten Zeitzeugen zu verlieren. Das Gedächtnis verblasst. Ohne aktives Erinnern droht die Vergangenheit zu verschwinden. Deshalb ist „Vom Erinnern zum Gedenken“ auch ein Aufruf: Erinnern Sie sich weiter. Erinnern Sie sich weiter. Nicht nur aus Respekt vor denjenigen, die nicht mehr hier sind, sondern auch, weil es etwas darüber aussagt, wer wir sein wollen. Als eine Stadt und als eine Gemeinschaft.
Diese vier Bedeutungsebenen spiegeln sich in den Geschichten wider, die wir zeigen - von jüdischen Groningern, die den Krieg überlebt haben, jeder auf seine Weise. Aber auch in Denkmälern, in Feiern, im Schweigen. In dem, was gesagt wurde, und in dem, was lange Zeit ungesagt blieb. Die Ausstellung ist nicht allumfassend, sondern versucht zu zeigen, wie sich die Erinnerungskultur entwickelt hat. Wie das Schweigen langsam gebrochen wurde. Wie und für wen Denkmäler errichtet wurden. Wie man gemeinsam trauert - und weiterlebt. Und gerade heute, 80 Jahre später, ist das Erinnern wichtiger denn je. Denn während wir hier an eine Vergangenheit der Verfolgung und Zerstörung erinnern, sehen wir heute eine Welt voller Gewalt, Krieg und Polarisierung. Das verlangt etwas von uns. Dass wir uns weiterhin für Menschlichkeit entscheiden - auch wenn die Realität komplex ist. Dass wir uns weiterhin der Entmenschlichung des Anderen widersetzen, egal wo.
In den vergangenen 80 Jahren gab es viele Diskussionen darüber, wie, wo und wem wir gedenken. Die Diskussionen, die heute geführt werden, sind also nicht neu. In diesem Sinne ist das Gedenken auch eine Freiheit: die Tatsache, dass wir nachdenken dürfen und können, Fragen stellen, entscheiden, woran wir uns erinnern wollen. Es ist kein festgelegtes Ritual, sondern ein lebendiger Prozess. Erinnern bedeutet nur etwas, weil wir uns jedes Mal dafür entscheiden. Diese Ausstellung ist bis zum 12. Oktober in der Synagoge Groningen zu sehen.

Diese Ausstellung wurde durch einen Beitrag von „80 Jahre Freiheit Groningen“ ermöglicht. Ermöglicht wird dies durch die Provinz Groningen, alle Groninger Gemeinden, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds und VSB fonds. Helga de Graaf vom Studio Eye-Candy kümmerte sich um die Gestaltung der Ausstellung. Wir danken allen Leihgebern wie dem Groninger Archieven, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal und verschiedenen Privatpersonen, die uns Objekte, Fotos und Geschichten zur Verfügung gestellt haben.